Die Bundeswehr plant, im Zuge ihrer Digitalisierung auf Cloud-Lösungen des US-Konzerns Google zu setzen – das ruft scharfe Kritik von CDU und Grünen hervor, die Sicherheitsrisiken und Abhängigkeiten sehen.
Im Mittelpunkt steht eine geplante Kooperation zwischen der BWI, dem IT-Dienstleister des Bundes, und Google, um die Digitalisierung der Bundeswehr voranzutreiben. CDU-Abgeordneter Roderich Kiesewetter äußerte große sicherheitspolitische Bedenken und plädierte für vorrangig europäische oder deutsche IT-Lösungen, um geopolitische Abhängigkeiten und eine mögliche Erpressbarkeit zu vermeiden. Konstantin von Notz, stellvertretender Grünen-Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Geheimdienst-Kontrollgremiums, forderte ebenfalls, die Risiken von US-Cloudanbietern kritisch zu prüfen und betonte, dass bestehende Abhängigkeiten nicht weiter verstärkt werden dürfen. Beide Politiker verwiesen auf die Unsicherheiten im transatlantischen Verhältnis, insbesondere unter Donald Trump, dessen unvorhersehbare Politik zu Vertrauensproblemen führe. Als Beispiel nannte von Notz den Fall der von Washington verhängten Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof, in deren Folge Microsoft Zugang zu kritischen E-Mail-Konten sperrte – eine Situation, deren Folgen für die Bundeswehr deutlich riskant sein könnten. Dem entgegen steht die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die versichert, die Kontrolle über die Daten bleibe bei der Bundeswehr: Daten würden ausschließlich in Deutschland gespeichert und in eigenen BWI-Rechenzentren betrieben, wodurch sie nicht dem US-Recht unterlägen und keine externen Sicherheitsrisiken bestünden.
Die Kontroverse um den Einsatz von Google-Technologien bei der Bundeswehr steht exemplarisch für die breitere europäische Debatte über digitale Souveränität und den Umgang mit globalen IT-Anbietern. In Sicherheits- und Verteidigungskreisen wird verstärkt der Ruf nach einem EU-eigenen Cloud-System laut, wie es zum Beispiel das europäische Projekt GAIA-X anstrebt, um technologische und rechtliche Unabhängigkeit zu gewährleisten. Nach aktuellen Berichten raten nicht nur Politiker, sondern auch zahlreiche Digitalexperten dazu, die technologische Selbstbestimmung europäischer Staaten zu stärken, und sehen zudem eine indirekte Gefahr durch mögliche zukünftige außenpolitische Verschiebungen, die den Zugriff oder die Verfügbarkeit kritischer IT-Infrastrukturen einschränken könnten.
- Laut einem Bericht auf spiegel.de werden im Zuge der aktuellen Bundeswehr-Digitalisierung weitere Debatten um europäische IT-Souveränität und das Auftreten internationaler Großkonzerne entfacht; der Artikel beleuchtet auch, dass regulatorische Lücken in der EU dazu führen könnten, dass vertrauliche Daten unter bestimmten Umständen doch im Ausland landen (Quelle: Spiegel Online).
- Ein Hintergrundbericht von sueddeutsche.de erklärt, dass die Bundeswehr zwar betont, volle Kontrolle über Daten und Infrastruktur zu behalten, dennoch viele Sicherheitsexperten auf Herausforderungen bei der technischen Absicherung, etwa vor Spionage oder Sabotage, hinweisen. Zudem wird kritisch hinterfragt, inwiefern der Betrieb in deutschen Rechenzentren tatsächlich vollständigen Schutz vor Zugriffen durch ausländische Behörden bietet (Quelle: Süddeutsche Zeitung).
- Die faz.net analysiert die geopolitischen und rechtlichen Implikationen, die mit der Nutzung von Cloud-Technologien aus Nicht-EU-Staaten einhergehen, wobei vor allem das Risiko plötzlicher politischer Kurswechsel der Partnerländer betont wird. Im Fokus stehen außerdem die strategische Bedeutung digitaler Infrastruktur im Verteidigungsfall und der Vergleich mit ähnlichen Initiativen in anderen europäischen Armeen (Quelle: FAZ).
Redaktion poppress.de, gkleber



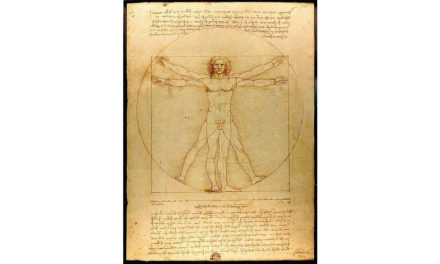







Kommentare