Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska fordern führende Vertreter von Union, SPD und Grünen, die in Europa blockierten Milliardenvermögen der russischen Zentralbank umgehend vollständig für die Unterstützung der Ukraine zu verwenden.
Zu den Unterstützern dieser Forderung zählen aus der CDU Ministerpräsident Boris Rhein, Norbert Röttgen, Jürgen Hardt, Thomas Röwekamp, Roderich Kiesewetter sowie die Ex-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch CSU-Politiker Thomas Erndl steht dahinter. Schätzungen zufolge belaufen sich die eingefrorenen Vermögenswerte russischer Staatskonten weltweit auf etwa 260 Milliarden Euro, vor allem in europäischen Ländern. Aktuell werden ausschließlich die Zinserträge dieser Gelder an die Ukraine weitergeleitet, was deutlich geringere Beträge sind. Versuche, das gesamte Vermögen zu beschlagnahmen, stoßen laut Informationen aus Brüssel insbesondere in Deutschland und Frankreich weiterhin auf Skepsis.
Die Forderung nach der Konfiskation russischer Zentralbankguthaben gewinnt im Vorfeld eines Treffens von Trump und Putin an Dynamik: CDU-, CSU-, SPD- und Grünen-Politiker sprechen sich klar dafür aus, die eingefrorenen Milliarden in der EU nicht länger unangetastet zu lassen und als bedeutende Unterstützung für die Ukraine freizugeben. Argumentiert wird, dass ein solches Vorgehen ein starkes Zeichen gegen Russlands Strategie im Krieg setzen und nach dem Verursacherprinzip zur Kompensation der Kriegsschäden beitragen würde. Rechtliche und politische Bedenken bestehen jedoch weiterhin; insbesondere Frankreich und Deutschland bremsen solche Schritte aus Sorge um Präzedenzfälle im internationalen Finanzsystem und um diplomatische Konsequenzen (Recherche-Update: Einem aktuellen Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge fordern auch US-Vertreter, den Druck auf Moskau zu erhöhen, indem sie den Zugang zu russischen Vermögenswerten einschränken; gleichzeitig warnt die FAZ, eine solche Konfiskation könnte internationale Rechtsnormen tragen und Verunsicherung an den Finanzmärkten schaffen. Die Zeit berichtet, dass in der EU weiter über eine rechtliche Grundlage für die Umsetzung gerungen wird und eine gemeinsame Linie bisher nicht gefunden wurde).
- Süddeutsche Zeitung: In einem aktuellen Hintergrundbericht erläutert die SZ, dass die Debatte um die Einziehung eingefrorener russischer Staatsvermögen angesichts zunehmender Kriegszerstörungen in der Ukraine weiter an Schärfe gewinnt. Mehrere EU-Staaten, allen voran die baltischen Länder und Polen, setzen sich demnach vehement für eine Beschlagnahmung der Guthaben ein, stoßen allerdings weiter auf Widerstand insbesondere aus Paris und Berlin. Die SZ sieht zudem zunehmenden Druck aus den USA, einen gemeinsamen Weg zu einer umfassenden Vermögensübertragung an die Ukraine zu finden (Quelle: Süddeutsche Zeitung).
- Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Laut einem aktuellen FAZ-Artikel sind die rechtlichen Hürden für die vollständige Konfiskation russischer Zentralbankreserven weiterhin sehr hoch; Experten warnen vor verfassungs- und völkerrechtlichen Folgen, sollten Einfrierungen dauerhaft in Enteignungen umgewandelt werden. Die FAZ berichtet außerdem, dass einige europäische Banken und Staaten negative Auswirkungen auf die Rolle des Euro fürchten und einen Präzedenzfall vermeiden möchten. Gleichzeitig wächst der politische Druck, angesichts der anhaltenden Angriffe auf die Ukraine ein Zeichen zu setzen (Quelle: FAZ).
- Zeit Online: Zeit.de betont in einem aktuellen Beitrag die Rolle der Rechtsstaatlichkeit und der Notwendigkeit klarer internationaler Regeln für die Nutzung eingefrorener staatlicher Gelder. Während der politische Druck auf eine schnelle Lösung steigt, wird in der EU noch an einem rechtlich tragfähigen Rahmen gearbeitet. Die Zeit hebt hervor, dass die Verhandlungen auch in den kommenden Wochen von starken Meinungsdifferenzen geprägt sein dürften (Quelle: Zeit Online).
Redaktion poppress.de, gkleber



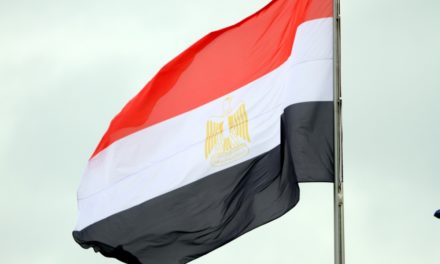




Kommentare