Mit knapp 29 Wochenstunden ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf in Deutschland so hoch wie nie seit 1990, hauptsächlich dank zunehmender Erwerbstätigkeit von Frauen.
Eine neue Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt: Der Hauptgrund für die gestiegene Pro-Kopf-Arbeitszeit in Deutschland ist der Zuwachs an berufstätigen Frauen. Während Männer im Vergleich zu 1991 kaum Veränderungen bei der durchschnittlichen Arbeitszeit aufweisen, stieg die Arbeitszeit von Frauen von etwa 19 auf über 24 Wochenstunden an. „Der Anstieg resultiert aus einer deutlich höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen. Zwar arbeiten viele weiterhin in Teilzeit, doch der Zuwachs der erwerbstätigen Frauen gleicht das mehr als aus“, erläutert Harun Sulak vom BiB. In den vergangenen 30 Jahren ist der Anteil berufstätiger Frauen nahezu um ein Drittel gestiegen. Noch besteht weiteres Potenzial: Die von Frauen als ideal beschriebene Arbeitszeit liegt immer noch über dem aktuellen Durchschnitt, was familienpolitische Maßnahmen wie mehr Kinderbetreuung erforderlich macht. Bei Männern blieb die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf nach einem Rückgang in den 1990ern und einem Zwischenhoch konstant. Während die Erwerbsquote bei Männern – besonders bei Älteren – gestiegen ist, arbeiten sie im Durchschnitt heute 2,6 Stunden pro Woche weniger. Insgesamt zeigen die Daten: Der Unterschied zwischen den Geschlechtern schrumpft, was nicht nur auf Veränderungen im Arbeitsmarkt, sondern auch auf gesellschaftlichen Wandel hindeutet. Die Auswertung umfasst alle Menschen zwischen 20 und 64 Jahren – egal, ob sie aktuell erwerbstätig sind.
Die Arbeitszeit pro Kopf in Deutschland hat laut BiB-Analyse mit durchschnittlich 29 Wochenstunden ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht, getragen vor allem vom steigenden Anteil arbeitender Frauen. Seit 1991 stieg die Wochenarbeitszeit der Frauen um mehr als fünf Stunden, während sie bei Männern annähernd konstant blieb. Hintergrund dieser Entwicklung sind gesellschaftliche und arbeitsmarktpolitische Veränderungen, wie ein verbessertes Angebot an Kinderbetreuung und eine stärkere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. Laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung befürworten mittlerweile mehr als die Hälfte aller Mütter mit Kindern unter 14 Jahren eine Arbeitszeit von 30 Wochenstunden oder mehr. Auch internationale Vergleiche zeigen, dass in skandinavischen Ländern mit ausgeprägter Kinderbetreuung die Erwerbsquote von Frauen besonders hoch liegt. Ein Bericht vom Statistischen Bundesamt betont, dass die Ausweitung flexibler Arbeitsmodelle – Homeoffice und Teilzeit – insbesondere Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert und zur Reduzierung des Gender Gaps beiträgt.
- Der Artikel auf www.zeit.de berichtet über die steigende Arbeitszeit von Frauen und wie der Abbau traditioneller Rollenmuster sowie bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten dazu geführt haben, dass immer mehr Frauen in Deutschland erwerbstätig sind. Familienpolitische Maßnahmen wie verlängerte Elternzeit und finanzielle Anreize tragen laut Zeit zur weiteren Erhöhung der Frauenbeschäftigung bei. Zudem zeigt der Artikel auf, dass vor allem Mütter wünschen, noch mehr Wochenstunden zu arbeiten, sofern die Vereinbarkeit mit der Familie gegeben ist (Quelle: Zeit Online).
- www.spiegel.de analysiert die Auswirkungen des Trends auf den deutschen Arbeitsmarkt und stellt fest, dass höhere Frauenbeschäftigung zur Linderung des Fachkräftemangels beiträgt. Die Analyse hebt hervor, dass ohne den Zuwachs an weiblicher Arbeitskraft die Wirtschaftsleistung Deutschlands in den vergangenen Jahren deutlich schwächer ausgefallen wäre. Gleichzeitig mahnen die Autoren, dass reformbedürftige Arbeitszeitmodelle und unzureichende Betreuungsangebote weitere Fortschritte behindern könnten (Quelle: Der Spiegel).
- Laut www.sueddeutsche.de ist der rückläufige Gender Gap bei der Arbeitszeit nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine gesellschaftliche Errungenschaft. Die Redaktion hebt hervor, dass Väter zunehmend Elternzeit nutzen und flexible Arbeitszeiten nachfragen, was die traditionelle Rollenverteilung weiter aufweicht. Gleichzeitig bleibt der Handlungsbedarf in der Weiterentwicklung der Ganztagsbetreuung und bei der Entlohnung von Teilzeitarbeit bestehen (Quelle: Süddeutsche Zeitung).
Redaktion poppress.de, gkleber

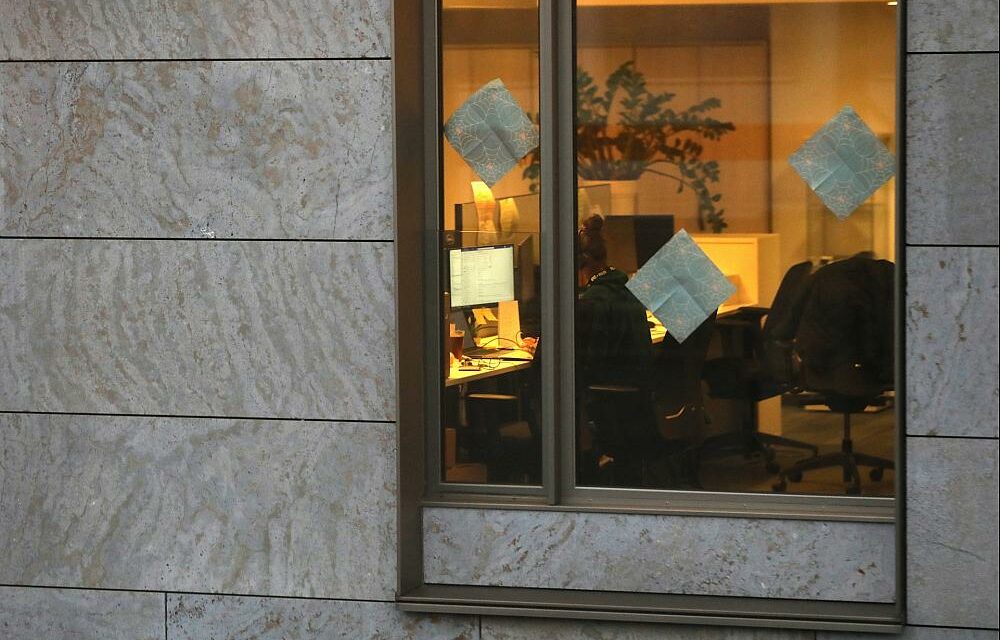














Kommentare